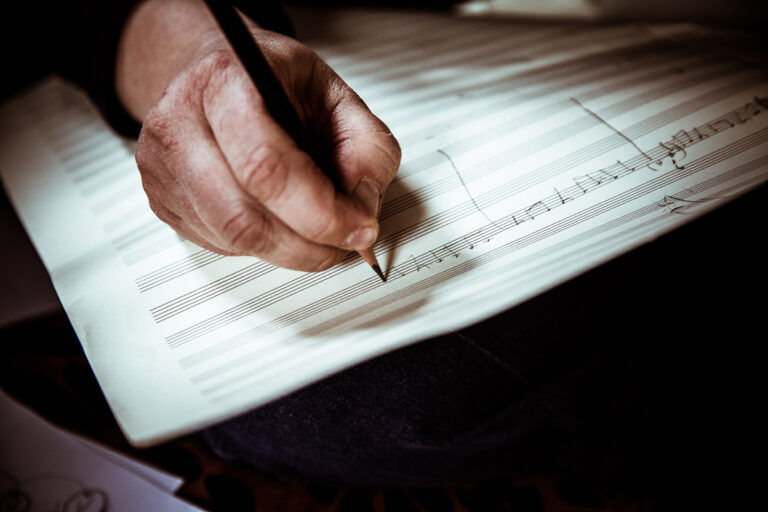Wenn man vor den Bahnhof Einsiedeln tritt, sieht man schon nach wenigen Schritten ein gross mit «jodel.ch» beschriftetes Schaufenster. Nadja Räss hat offensichtlich keine Scheu vor neuen Medien und betrachtet Jodeln nicht als reine Tradition, die nur in der Praxis vermittelt werden kann. Denn in diesem kleinen Ladenlokal unterrichtet sie und ihr Team Jodeln in verschiedenen Formaten, sogar online, auch eine jodelspezifische Stimmbildung bietet sie an. Auf ihrer Website erklärt sie, dass man «das verstaubte Image des Jodelns» hinter sich lasse. Aber auch, dass im Unterricht «das urtümliche Singen als eine zeitlose und vielseitige Ausdrucksform auf der Basis einer fundierten Stimmbildung» vermittelt werde.
Berufswunsch Jodlerin
Die Herkunft von Nadja Räss erklärt ihre Freude am Jodeln, aber auch ihre stilistische Offenheit. Sie wurde im schwyzerischen Einsiedeln geboren und ist dort auch aufgewachsen. Ihre Eltern aber stammen beide nicht aus Einsiedeln; sie lernten sich dort kennen und lieben. «Meine Eltern sind beide nicht Musiker, obwohl sie als Hobby musiziert haben. Und zuhause war immer Musik zu hören, vor allem Jodelmusik, und ich habe offenbar immer gesungen.» Nadja wollte denn auch schon als Kind Jodlerin werden. Das sei ihr zumindest erzählt worden. Aber sie wisse ganz sicher, dass sie schon als kleines Kind eng in Berührung mit dem Jodeln gekommen sei, nicht nur mit der der Innerschweizer Tradition.
«Als Appenzeller pflegte mein Vater mit seinen Brüdern weiterhin den Brauch des Silvesterklausens, weshalb wir öfter ins Appenzell fuhren, als ich noch ganz klein war.» Das habe sie vermutlich nicht bewusst wahrgenommen, und später sei man nicht mehr hingefahren. Aber im Alter von etwa 18 Jahren habe sie es realisiert, als sie zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ans Silvesterklausen ging. «Da hatte ich ein krasses Déjà-vu-Erlebnis. Ich glaube, das Silvesterklausen hat mich sehr geprägt. Denn es beinhaltet eine total archaische und direkte Art von Jodeln.»
Der Weg zur beruflichen Jodlerin war aber noch weit. «Ich bin mit der Absicht ins Gymnasium gegangen, dass eine Matura nicht schlecht ist, wenn ich die Musik zum Beruf machen will.» Die Eltern ermöglichten es ihr, an die private Stiftschule im Kloster Einsiedeln zu gehen statt an die Kantonsschule in Pfäffikon SZ. «Ich wusste natürlich, dass es dort einen coolen Chor hat, der gregorianische Choräle singt. Um da einmal in der Woche mitsingen zu können, musste ich allerdings ministrieren und um 6.30 Uhr antraben.»
Eine bestechende Kombination
Von verschiedener Seite wurde Nadja Räss damals erklärt, dass Musik brotlos und streng sei – um einen «richtigen» Beruf komme man nicht herum. Sie überlegte sich etwa, Primarlehrerin zu werden, schnupperte ein bisschen und merkte: «Nein, das geht gar nicht». Auch die Gastronomie kam in Frage; Gastgeberin zu sein, finde sie auch heute noch etwas Schönes. «Aber ich merkte, dass man dann am Wochenende arbeiten muss, ich also nicht mehr jodeln könnte.» Als bestechende Kombination kristallisierte sich eine Kombination von Musik und Pädagogik heraus. Und so studierte sie nach der Matura an der Zürcher Hochschule der Künste klassischen Gesang und schloss dieses Studium 2005 mit dem Master in Pädagogik ab. Von 2012 bis 2017 war sie Intendantin der Kulturinstitution «Klangwelt Toggenburg». Als «leidenschaftliche Lehrerin» gibt sie ihr Wissen nicht nur an Kursen von «jodel.ch» weiter, sondern seit Herbst 2018 auch als Professorin für «Jodel» an der Hochschule Luzern.
Aber wie geht das zusammen: klassischer Gesang und Jodel? «Vor mehr als 20 Jahren konnte man noch nicht mit einem Studium des Jazzgesangs eine fundierte fachdidaktische Ausbildung erhalten, deshalb studierte ich klassische Gesangspädagogik.» Wie hat dies ihre Art des Gesangs verändert? «Auf der einen Seite hat es den Tonumfang meiner Stimme und meinen musikalischen Horizont enorm erweitert. Ich habe plötzlich Stücke gesungen, die harmonisch viel komplexer – und länger sind; bis dahin hatte ich maximal vier Minuten dauernde Jodel-Lieder gesungen.» Was ihr zu Beginn Mühe machte, sind zwei unterschiedliche Zugänge zur Musik. «In der klassischen Musik ist alles fein säuberlich vorgegeben. Der Komponist schreibt jede Regung in die Note. Vom Jodel her aber war ich über das Hören konditioniert, da dieser von einer oralen Tradition geprägt wird.»
«Den Studierenden vermittle ich, dass es spannend und bereichernd ist, wenn diese beiden Zugangsebenen zusammenkommen. Entsprechend müssen meine Studierenden auch Naturjodel transkribieren, die Vokalisation herausschreiben.» Nadja Räss hat als Professorin für Jodeln aber auch selbst profitiert. «In dem Moment, in dem ich jemandem etwas erkläre, muss ich mir ganz genau überlegen, wie ich es selbst mache.» Schon bei ihrem eigenen Studium habe sie gemerkt, dass ihr vieles selbstverständlich war, weil sie es über das kindliche Lernen automatisch erfasst habe.
Ein Fall für den Stimmarzt
Dies habe zu einer Neuentdeckung ihrer Stimme geführt, erklärt Nadja Räss. Und dies führte letztlich auch zum mit Franziska Wigger geschaffenen Lehrmittel «Jodel – Theorie & Praxis». «Dafür machten wir auch Stimmuntersuchungen, weil sich viele Fragen aufdrängten, etwa: Was geschieht da anatomisch? Stimmt es, dass man mit dem Jodeln die Stimme kaputt machen kann?» Dazu habe sie mit Stimmärzten zusammengearbeitet. Und der Lernprozess habe bis heute nicht aufgehört. «Mittlerweile darf ich auch Fachdidaktik unterrichten, also meine Studierenden unterrichten, wie man unterrichtet. Das ist ein schöner Prozess: zu sehen, wie es weitergeht.»
Der intellektuelle Zugang durch den Jodel-Studiengang stiess auch auf einen gewissen Widerstand, zumal er auch eine Erweiterung des Ausdruckspektrums und dadurch eine Abweichung von der Tradition ermöglicht. «Als das Studium neu war, gab es schwierige und aufreibende Situationen, Widerstand kam gerade auch aus der Jodelszene. Aber dieser entstand aus einer Angst heraus, weil man nicht wusste, was und wie am Studium unterrichtet wird. Und natürlich, Hochschule und Jodel, das klingt wie ein Widerspruch in sich, deshalb ist das geflügelte Wort des ‹akademisierten Jodels› entstanden.»
Ein Spiel mit Färbungen
Irgendwann habe sie gemerkt, dass das Problem auch daran liege, dass man weitherum nicht gewusst habe, was in diesem Studiengang angeboten wird, was am Anfang auch nicht so klar gewesen sei. Die Situation habe sich seither beruhigt, erklärt Nadja Räss, auch weil sie besser informierten. «Wir wollen die Tradition ja nicht verwässern oder mit anderen vermischen. Aber mir ist es wichtig, dass beispielsweise auch eine Thurgauer Studentin eine Ahnung vom Muotathaler Naturjodeln hat. Vielleicht kommt einmal ein Muotathaler zu ihr in die Stunde und sagt, er habe Stimmprobleme.»
Aber könnte es nicht verlockend sein, in der Muotathaler Art zu singen und dann eine Appenzeller-Färbung hineinzubringen? «Wenn ich traditionelle Stücke singe, versuche ich, möglichst nah daran zu bleiben. Aber wenn ich neue Kompositionen singe, fliessen genau solche neuen Färbungen hinein. Es ist wie eine Palette von Klängen und Färbungen, und diese Palette ist über die Jahre gewachsen, es gibt viele Farbnuancen. Das ist ein Spiel mit der Stimmfarbe, das unbewusst passiert.» Nadja Räss betont denn auch, dass neue Kompositionen eine sehr grosse Bedeutung hätten, um die Tradition lebendig zu halten. «Sie sind ein wichtiges Merkmal dafür, dass sich die Volksmusik ständig weiterentwickelt. Ich glaube, daraus können wir schöpfen. Aber damit wir die neuen Pflänzchen entstehen lassen können, ist es auch wichtig, dass man die Wurzeln kennt und pflegt.»
Neue Kompositionen sind meist Gemeinschaftswerke
Wenn Nadja Räss neue Musik schreibt, habe sie in den meisten Fällen das grosse Glück, dass andere Musiker mitwirkten. «Während des Spielens entstehen so Gemeinschaftswerke. Im Duo mit Markus Flückiger haben wir lange herumgepröbelt und ausprobiert, um das neue Programm zu erarbeiten.» Mit Rita Gabriel sei es so, dass sich diese jeweils recht genau ein Arrangement überlege. Nadja Räss betont, dass diese Herangehensweisen für sie «ein wahnsinnig schöner Prozess» sei. Und ja, das habe für sie auch eine soziale Qualität.
«Für mich steht im Vordergrund, mit wem ich ein Projekt mache.» Das Trio mit der Finnin Outi Pulkkinen und der Ukrainerin Mariana Sadovska sei vor über zehn Jahren entstanden. Wir waren damit auch auf Tournee, doch dann sei das Projekt wegen Corona und später wegen des Ukrainekriegs brach gelegen. «Da es aber nicht nur Mitsängerinnen, sondern auch Freundinnen sind, haben wir beschlossen, es nochmals miteinander zu wagen. Wir haben ein neues Programm erarbeitet, wofür wir einige Stücke selber geschrieben, aber auch Aufträge vergeben haben an eine ukrainische, an eine schweizerische und eine finnische Komponistin. So sind sehr unterschiedliche Stücke zusammengekommen.»
In einer langen Tradition stehen
Nadja Räss wurde schon mehrfach ausgezeichnet, etwa 2014 mit dem «Prix Walo» für die Sparte «Jodel», 2016 gehörte sie zu den Nominierten für den Schweizer Musikpreis. Nun steht sie mit dem «Goldenen Violinschlüssel 2025» in einer langen Liste von Grössen der Schweizer Volksmusik, die bis ins Jahr 1979 zurückgeht. «Mich ehrt besonders, jetzt mit auf einer Liste zu stehen, auf der einige für meine Laufbahn bedeutsame Vorbilder stehen. Ganz, ganz wichtig ist mir Willi Valotti. Mit ihm verbindet mich eine lange musikalische Freundschaft: Ich darf mit ihm auftreten und singen, seit ich etwa 15 Jahre alt bin, was für mich bis heute sehr, sehr prägend ist.» Von ihm habe sie gelernt, ganz genau auf Eigenheiten von unterschiedlichen Jodel-Traditionen zu hören. «Ohne Willi Valotti und seine neuen Lieder würde ich heute nicht hier stehen – und ausgezeichnet werden.»
www.goldenerviolinschluessel.ch Website des Vereins Goldener Violinschlüssel
www.nadjaraess.ch Website von Nadja Räss
www.jodel.ch Website von Nadja Räss und ihrem Team zum Jodelunterricht
Die SUISA unterstützt den Verein «Goldener Violinschlüssel». Dieser verleiht seit 1979 diese Auszeichnung im Bereich der Schweizer Volksmusik.